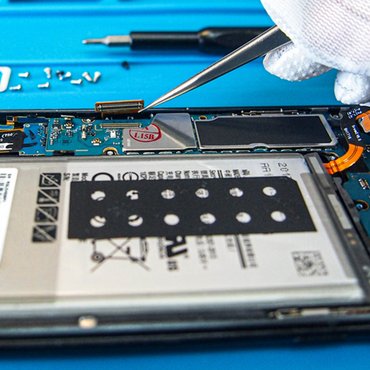EuGH-Vorlage: Haftung der Geschäftsführung für Kartellbußgelder
Der Kartellsenat des BGH hat mit Beschluss vom 11. Februar 2025 dem EuGH die Frage vorgelegt, ob es mit EU-Recht vereinbart ist, wenn Unternehmen ihre Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder für Kartellbußgelder in Regress nehmen.
Sachverhalt
Dem Beschluss des BGH liegt die Organhaftungs-Klage einer GmbH sowie einer AG zugrunde. Der Beklagte war Geschäftsführer der GmbH und zugleich Vorstandsmitglied der AG. Er beteiligte sich an einem Preiskartell. Das Bundeskartellamt verhängte deshalb Bußgelder gegen die GmbH in Höhe von ca. EUR 4,1 Mio. und gegen den Beklagten in Höhe von EUR 126.000. Die Klägerinnen verlangen nunmehr von dem Beklagten Schadenersatz in Höhe des gegen die GmbH verhängten Bußgelds sowie Ersatz für die der AG zur Abwehr des Bußgelds entstandenen IT- und Anwaltskosten in Höhe von EUR 1 Mio. Zugleich begehren sie die Feststellung, dass der Beklagte auch alle weiteren Schäden zu ersetzen hat, die aus dem Kartellverstoß folgen.
Die Vorinstanzen, das Landgericht Düsseldorf (Urt. v. 10.12.2021 – 37 O 66/20 [Kart]) sowie das OLG Düsseldorf (Urt. v. 27.7.2023 – 6 U 1/22 [Kart]), haben die Klagen auf Erstattung des Bußgelds und der Rechtsverteidigungskosten abgewiesen. Der Beklagte sei lediglich zum Ersatz der aus dem Kartellverstoß resultierenden weiteren Schäden verpflichtet. Beide Gerichte haben angenommen, dass der Anwendungsbereich der gesellschaftsrechtlichen Organhaftungsvorschriften gem. § 43 Abs. 2 GmbH sowie § 93 Abs. 2 AktG aufgrund der Sanktionszwecke von §§ 81a bis 81d GWB teleologisch zu begrenzen sei. Die Haftungsvorschriften würden sich daher nicht auf Schäden erstrecken, die Unternehmen wegen gegen sie verhängter Kartellbußgelder sowie zur Abwehr des Bußgelds entstandener IT- und Anwaltskosten entstehen. Eine Inanspruchnahme des Beklagten komme daher auch aus anderen grundsätzlich in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen nicht in Frage.
Das OLG hat die Revision zum BGH gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen, da bislang keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu der umstrittenen Frage vorliegt, ob im Fall der Verhängung eines Verbandskartellbußgeldes gegen ein Unternehmen ein Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegen sein (ehemaliges) Leitungsorgan besteht oder ob die Sanktionszwecke des deutschen Kartellrechts es gebieten, die Haftung des Organs nach § 43 Abs. 2 GmbHG bzw. § 93 Abs. 2 AktG teleologisch zu beschränken (zu diesem Meinungsstreit siehe OLG Düsseldorf Urt. v. 27.7.2023 – 6 U 1/22 [Kart], NZG 2023, 1279, Rn. 132 ff.).
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Anders als die Vorinstanzen sieht der BGH die Notwendigkeit, dazu ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu richten.
Der BGH weist daraufhin, dass zwar der Sachverhalt grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch gegen den Beklagten begründet. Es sei aber umstritten, ob ein danach möglicher Rückgriff auf das Vermögen des Geschäftsführers dem Sinn und Zweck der Verbandsbuße widerspreche, so dass eine einschränkende Auslegung der gesellschaftsrechtlichen Haftungsnormen geboten sei. Für die Klärung dieser Frage sei auch erheblich, ob das Unionsrecht eine in Betracht kommende einschränkende Auslegung gebietet.
Insoweit sei zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH die Mitgliedstaaten sicherzustellen haben, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Geldbußen gegen Unternehmen verhängen können, wenn diese vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 101 AEUV verstoßen. Ziel der Geldbußen sei es, rechtswidrige Handlungen der betreffenden Unternehmen zu ahnden und sowohl diese Unternehmen als auch andere Wirtschaftsteilnehmer von künftigen Verletzungen der Wettbewerbsregeln des Unionsrechts abzuschrecken. Nach Ansicht des BGH könnte aber die danach gebotene Wirksamkeit von Geldbußen gegenüber Unternehmen beeinträchtigt sein, wenn sich die Gesellschaft von der Bußgeldlast durch Rückgriff auf das Leitungsorgan vollständig oder teilweise entlasten könnte.
In diesem Zusammenhang weist der BGH darauf hin, dass der EuGH zu erkennen gegeben habe, dass eine Geldbuße sehr viel von ihrer Wirksamkeit einbüßen könne, wenn das betroffene Unternehmen berechtigt wäre, sie auch nur teilweise steuerlich abzusetzen. Dementsprechend, so der BGH, stelle sich auch hier die Frage, ob die Abwälzung der Geldbuße des Unternehmens auf den Geschäftsführer nach Maßgabe gesellschaftsrechtlicher Vorschriften den Zweck der kartellrechtlichen Geldbuße beeinträchtigt.
(Pressemeldung des BGH zum Beschluss vom 11. Februar 2025 - KZR 74/23)

Melden Sie sich hier zu unserem GvW Newsletter an - und wir halten Sie über die aktuellen Rechtsentwicklungen informiert!