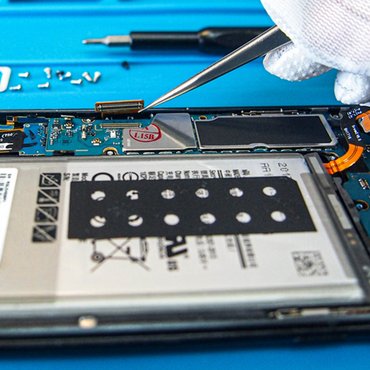Alleinstellungsmerkmal im Vergaberecht: EuGH mahnt erneut zur sorgfältigen Prüfung der Ausnahme!
Für Aufsehen hat zu Beginn des Jahres 2025 die Entscheidung des EuGHs gesorgt - die tatsächlichen Konsequenzen dieser Entscheidung werden erst bei einem näheren Blick deutlich und die Auswirkungen werden sich letztlich in der Praxis zeigen. Klar ist jedenfalls, dass der EuGH damit ein weiteres Exempel für die Stärkung des Wettbewerbs statuiert, indem er die hohen Anforderungen an die Begründung eines Alleinstellungsmerkmals noch einmal betont (siehe ausführlich EuGH, Urteil vom 09.01.2025 zur RL 2004/18/EG Art. 31 Nr. 1 b) in der Rechtssache C-578/23).
Sachverhalt
Der Entscheidung des EuGHs lag der folgende Sachverhalt zugrunde:
Im Jahr 1992 schloss das Finanzministerium der Tschechischen Republik (das Ministerstvo financí) einen Vertrag mit dem IT-Unternehmen IBM World Trade Europe/Middle East/Africa Corporation (IBM World) ab, auf dessen Grundlage ein Informationssystem für die tschechische Steuerverwaltung geschaffen wurde. Es wurde damals kein wettbewerbliches Auswahlverfahren durchgeführt.
An Stelle des tschechischen Finanzministeriums trat die Steuerverwaltung der Generalfinanzdirektion der Tschechischen Republik („GFD“ – die Generální finanční ředitelství) und vergab, im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung, im Jahr 2016 einen Folgeauftrag über Wartungsleistungen an dem im Jahr 1992 beschafften Informationssystem im Wert von ca. 1,3 Mio. EUR (netto) an die Tochtergesellschaft die IBM Česká republika spol. s r. o., deren einziger Gesellschafter damals die IBM World war. Begründet wurde der Rückgriff auf dieses Verfahren durch die notwendige technische Kontinuität zwischen dem Informationssystem und seiner Wartung nach Garantiezeit sowie dem Schutz der ausschließlichen Urheberrechte am Quellcode des Systems.
Kurz nach der Vergabe des Auftrages erhob das tschechische Amt für Wettbewerbsschutz („Wettbewerbsamt“ – dem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) jedoch den Vorwurf, die Vergabe des Auftrages, mittels eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung wäre unzulässig gewesen, denn die GFD müsse sich das Verhalten ihres Rechtsvorgängers, des Finanzministeriums der Tschechischen Republik, zurechnen lassen. Das Vorliegen der Ausschließlichkeit resultiere nämlich, nach Ansicht des tschechischen Wettbewerbsamtes, aus dem Verhalten des Finanzministeriums. Dem hielt die GFD entgegen, dass zum Zeitpunkt des ersten Vertragsschlusses im Jahre 1992 die europäischen Regelungen noch keine Anwendung gefunden hätten, und der Auftragnehmer bereits zu diesem Zeitpunkt der einzige Wirtschaftsteilnehmer gewesen sei, der die Leistungen zu erbringen vermochte. Zudem trug die Tschechische Behörde vor, sie wäre nicht in der Lage gewesen, sich aus diesem entstanden Abhängigkeitsverhältnis zu lösen, denn der Auftragnehmer habe auf Nachfragen der GFD eine Übertragung der Verwertungsrechte an dem Quellcode des Informationssystems stets verweigert. Auf eine solche Weitergabe sei die Finanzverwaltung jedoch angewiesen gewesen, da das vorhandene System ansonsten bei einer Neuausschreibung unbrauchbar geworden wäre, und die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben nicht weiter hätten erfüllt werden können.
Diese Argumentation zweifelten jedoch nicht nur das tschechische Wettbewerbsamt, sondern auch die darauffolgenden gerichtlichen Instanzen an. Das Oberste Verwaltungsgericht der Tschechischen Republik (das Nejvyšší správní soud) stellte dem EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahren deshalb die Auslegungsfrage,
„ist bei der Beurteilung, ob die materielle Voraussetzung für die Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung erfüllt ist, d. h., ob der öffentliche Auftraggeber nicht durch sein eigenes Verhalten eine Ausschließlichkeitssituation nach Art. 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18 herbeigeführt hat, zu berücksichtigen, unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Umständen der Vertrag über die ursprüngliche Leistung geschlossen wurde, auf dem die öffentlichen Folgeaufträge beruhen?“
(vgl. EuGH Urteil vom 09.01.2025 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 19).
Entscheidung des EuGHs
Als Antwort auf die ihm vorgelegte Frage, findet der EuGH in seiner Entscheidung vom 09.01.2025 klare Worte:
„Art. 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ist dahin auszulegen, dass sich der öffentliche Auftraggeber zur Rechtfertigung des Rückgriffs auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Sinne dieser Vorschrift nicht auf den Schutz von Ausschließlichkeitsrechten berufen kann, wenn der Grund für diesen Schutz ihm zuzurechnen ist. Eine solche Zurechenbarkeit ist nicht nur auf der Grundlage der den Abschluss des Vertrags über die ursprüngliche Leistung begleitenden tatsächlichen und rechtlichen Umstände, sondern auch auf der Grundlage derjenigen Umstände zu beurteilen, die den Zeitraum vom Vertragsschluss bis zu dem Zeitpunkt kennzeichnen, zu dem der öffentliche Auftraggeber das Verfahren zur Vergabe eines nachfolgenden öffentlichen Auftrags auswählt.“
(vgl. EuGH Urteil vom 09.01.2025 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 39).
Mit Nachdruck hält der EuGH also fest, dass sich Auftraggeber nicht auf die in den Richtlinien vorgesehene Ausnahme eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung aufgrund eines bestehenden Ausschließlichkeitsrechts berufen können, wenn ihnen die Existenz dieses Ausnahmetatbestandes zuzurechnen ist. Dieses Erfordernis muss mithin kumulativ zu den übrigen Voraussetzungen für die Wahl eines Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung erfüllt sein. Dies betonte auch der Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen vom 26.09.2024: „nemo auditur propriam turpitudinem allegans“ – Niemand darf sich auf sein eigenes, rechtswidriges Handeln berufen (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Manuel Campos Sánchez-Bordona vom 26.01.2024 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 47).
In die Beurteilung der Zurechenbarkeit sind zum einen die den Abschluss des ursprünglichen Vertrags begleitenden tatsächlichen und rechtlichen Umstände einzubeziehen. Zum anderen fällt das Verhalten des öffentlichen Auftraggebers ins Gewicht, bzw. sind die Umstände im Zeitraum vom ursprünglichen Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des nachfolgenden Auftrags zu beachten. Unbeachtlich hingegen wäre die Absicht des Auftraggebers, d.h. es spielt zunächst keine Rolle, ob er eine Ausschließlichkeit vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. Ausreichend dürfte sein, dass er die Ausschließlichkeitssituation zumindest nicht bewusst umgehen wollte. Es wird also deutlich, dass nunmehr für die Bewertung der Zulässigkeit der Verfahrenswahl eine weitaus längere zeitliche Komponente zu berücksichtigen sein dürfte.
Und das obwohl sich das vom EuGH aufgestellte Zurechenbarkeitskriterium nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut des Art. 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18/EG ergibt, ist nach Ansicht des EuGHs eine teleologische Reduktion der Ausnahmevorschrift vor dem Hintergrund des Hauptziels der europäischen Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen geboten (vgl. EuGH Urteil vom 09.01.2025 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 28 f.). So weist das Gericht in diesem Zusammenhang darauf hin, dass obwohl im Jahr 1992 die fehlende Rechtsübertragung an dem zu erstellenden Informationssystems mangels entgegenstehenden unionsrechtlichen Vorschriften noch nicht zu beanstanden gewesen war, dies spätestens seit Inkrafttreten der Richtlinie 2004/18/EG offensichtlich anders zu bewerten war, sodass eine Untätigkeit infolgedessen dem Auftraggeber zuzurechnen sei (vgl. EuGH Urteil vom 09.01.2025 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 35, 36). Der Auftraggeber hätte sich um die Übertragung der Rechte sorgen und die Ausschließlichkeitssituation beheben müssen, solange ihm die dafür tatsächlichen und wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung standen (vgl. EuGH Urteil vom 09.01.2025 in der Rechtssache C-578/23, Rn. 31).
Erschwerend kommt nämlich die dem Auftraggeber obliegende Beweislast der Nichtzurechenbarkeit hinzu. Auftraggeber müssen demnach nachweisen, dass ihnen das Vorliegen (die Schaffung und die Aufrechterhaltung) der Ausschließlichkeitssituation nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Doch wie kann Auftraggebern ein solcher Nachweis gelingen? Wie sollen Auftraggeber auf die geschilderte Zurechnungsproblematik reagieren, bzw., welche zusätzlichen Erwartungen an die Auftraggeber sind dem Urteil des EuGHs zu entnehmen?
Die daraus resultierenden vergaberechtlichen Fragen, bspw. welche Maßnahmen vom Auftraggeber zu ergreifen sind, um eine Ausschließlichkeit zu vermeiden, lässt der EuGH (leider) offen.
Bedeutung für die Praxis
Die Tragweite der Entscheidung für die Praxis bleibt abzuwarten, da die Umsetzung der nationalen Spruchkörper obliegen wird, insbesondere welche Maßnahmen und (finanzielle) Aufwände dem Auftraggeber überhaupt zugemutet werden können, um die Aufrechterhaltung bzw. Entstehung einer Ausschließlichkeitssituation zu verhindern. Es dürfte sich also stets um Fragen des Einzelfalls gemessen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und den Grundsätzen der Sparsamkeit und des Wettbewerbs handeln. Klar ist jedoch schon jetzt, dass Auftraggeber angehalten sein werden, besondere Sorgfalt bei der Begründung von Alleinstellungsmerkmalen walten zu lassen.
Für den Bereich von IT-Vergaben bedeutet dies:
Vor allem dann, wenn weitere Serviceleistungen in absehbarer Zeit neben der Beschaffung der ursprünglichen Software und Hardware benötigt werden, sollten etwaige Schnittstellenproblematiken und/oder die Übertragung von Nutzungs- und Urheberrechten so früh wie möglich ins Auge gefasst und der (zukünftige) Bedarf allumfassend beurteilt werden.
Zwar versucht der EuGH mit seiner Entscheidung einen ersten Maßstab für die Einordnung des Zurechnungskriteriums an die Hand zu geben, um die vorhandene Ambivalenz im Vergaberecht zwischen dem Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers und der Begründung eines Alleinstellungsmerkmal aufzulösen. Letztlich bleibt jedoch die Rechtsunsicherheit zurück, was nationale Gerichte als Nachweis dafür akzeptieren werden, dass dem Auftraggeber die Schaffung oder Aufrechterhaltung der Ausschließlichkeitssituation nicht zuzurechnen ist, denn die Beweislast hierfür verbleibt allein beim Auftraggeber. Damit dürften nicht nur weitreichende Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten einhergehen, sondern auch eine Obliegenheit des Auftraggebers, eine Abhängigkeit vom Bestandauftragnehmers (sog. Lock-In Problematik) zu vermeiden. Die Möglichkeiten einer geeigneten Vertragsgestaltung sollten diskutiert werden (bspw. durch eine sog. Call-Option), um eventuelle Abhängigkeiten vorzubeugen.
Die nationalen Vergabekammern haben in der Vergangenheit teils zu Gunsten des Leistungsbestimmungsrechts des Auftraggebers entschieden und damit den Vorrang gegenüber der Gewährleistung von Wettbewerb eingeräumt. So war der Auftraggeber nicht angehalten, trotz vorhandener Option im Vertrag zur Übertragung der Nutzungsrechte an Soft- und Hardware, von dieser Option für die Beschaffung einer Erweiterung des bestehenden Systems Gebrauch zu machen (vgl. Vergabekammer Bund, Beschluss vom 18.02.2016 – VK 2-137/15). Ob sich in Anbetracht der jüngsten und gegenständlichen EuGH-Rechtsprechung schon bald eine Abkehr dieser nationalen Rechtsprechung abzeichnet, bleibt mit Spannung abzuwarten.
Jedenfalls sollten auch Bestandsverträge einer kritischen Überprüfung unterzogen werden, um ggfs. der Aufrechterhaltung einer etwaigen Ausschließlichkeitssituation durch Nachverhandlungen begegnen zu können, sodass sich Auftraggeber im Lichte der neuen Rechtsprechung nicht der Gefahr des Vorwurfs der Untätigkeit ausgesetzt sehen müssen.
Obwohl die gegenständlich diskutierte Entscheidung des EuGHs vom 09.01.2025 zur Richtlinie 2004/18/EG erging, lassen sich überzeugende Argumente finden, die auf eine Übertragung der Rechtsgedanken auf die aktuell geltende Richtlinie 2014/24/EU schließen lassen. Zum einen trat die Richtlinie 2014/24/EU an die Stelle der Richtlinie 2014/24/EU, zum anderen dürften die europa- und vergaberechtlichen Grundsätze im Wege des Erst-Recht-Schlusses im Rahmen der aktuellen Richtlinie 2014/24/EU fortgelten. Zumal die Parallelvorschrift zu 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18/EG in Art. 32 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2014/24/EU den entscheidenden Zusatz erfahren hat, wonach die festgelegten Ausnahmen für die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung überhaupt dann nur gelten, „wenn es keine vernünftigen Alternative und Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsparameter ist“. Daraus ergibt sich, dass die Anforderungen an ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung im direkten Vergleich der Richtlinien mit der Zeit nur weiter angehoben wurden, sodass das kumulative Kriterium der Zurechenbarkeit erst recht im Zuge der Richtlinie 2014/24/EU gelten dürfte.
Im Ergebnis wird also die Komplexität der Rechtslage und die hohen Anforderungen an die rechtssichere Begründung von Ausschließlichkeitsrechten durch die Entscheidung des EuGHs verdeutlicht, sodass anzunehmen ist, dass sich die Problematik in Anbetracht der offenen Folgefragen sogar intensiviert haben dürfte.

Melden Sie sich hier zu unserem GvW Newsletter an - und wir halten Sie über die aktuellen Rechtsentwicklungen informiert!