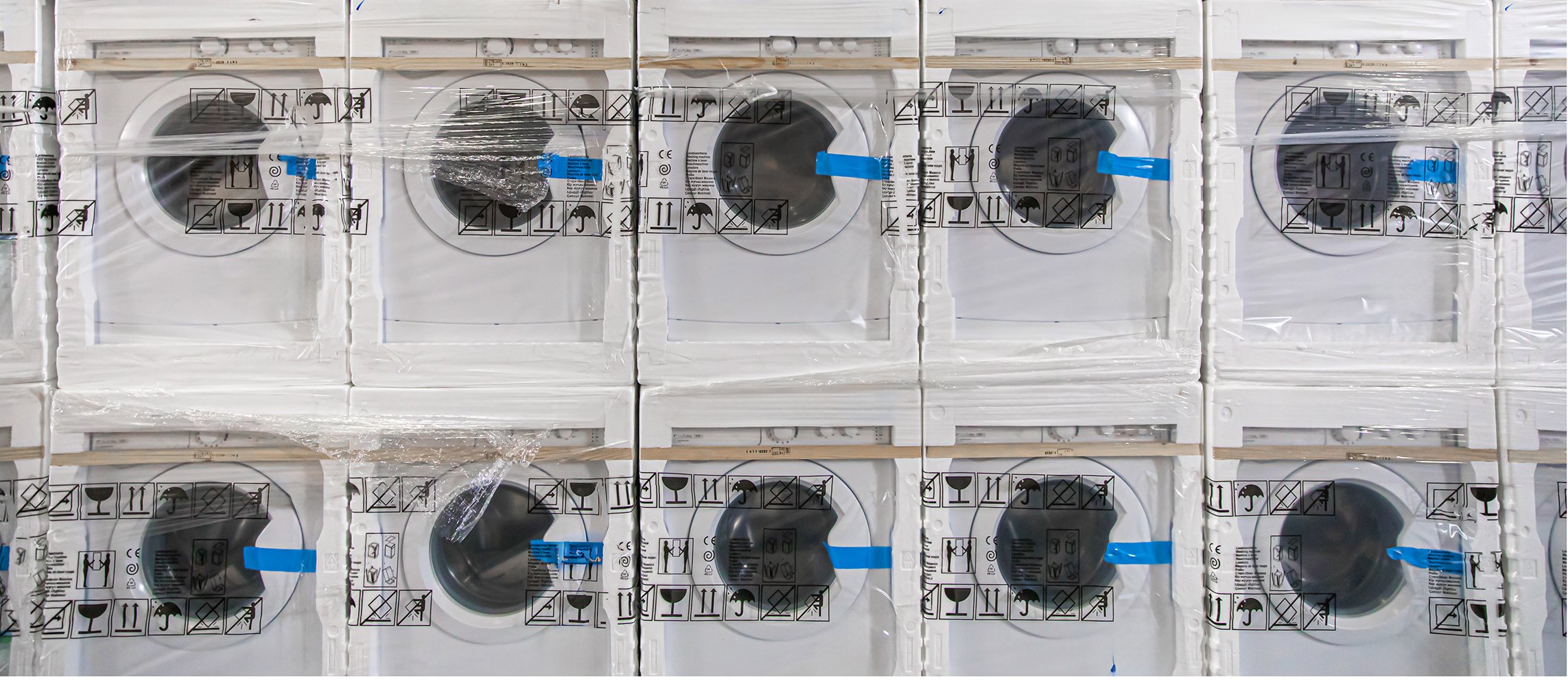Artikel 37 GPSR: Die neue Abhilfepflicht als Gamechanger im Produktsicherheitsrecht
Die europäische Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 („GPSR“), die seit dem 13. Dezember 2024 anwendbar ist, markiert einen Paradigmenwechsel für den B2C-Bereich. Ihr Ziel ist die Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts und die Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus. Mit Artikel 37 schafft die GPSR ein eigenständiges, unionsweites Abhilferegime für Rückrufe unsicherer Produkte – und erweitert damit die Haftungsrisiken für Hersteller, Importeure und Händler erheblich. Bemerkenswert ist, dass der Verbraucher zur Geltendmachung der Abhilfe lediglich einen Produktsicherheitsrückruf im Sinne von Artikel 3 Nummer 25 GPSR benötigt; ein Nachweis der Gefährlichkeit des konkreten Produkts ist nicht erforderlich. Der Anspruch begründet ein gesetzliches Schuldverhältnis eigener – gar unvergleichlicher – Art und ist in seiner Reichweite und Praxisrelevanz kaum zu überschätzen.
Dreiklang der Abhilfen: Reparatur, Ersatz, Erstattung
Artikel 37 sieht drei Abhilfevarianten vor: Reparatur, Ersatz und Erstattung des Produktwerts. Wirtschaftsakteure müssen im Rahmen des Rückrufs mindestens zwei dieser Maßnahmen anbieten, es sei denn, alternative Abhilfen sind unmöglich oder unverhältnismäßig. Maßstab der Verhältnismäßigkeit ist dabei primär die Unannehmlichkeit für den Verbraucher; die Abhilfe muss zeitnah und kostenfrei erbracht werden.
Reparaturen können, sofern der verantwortliche Wirtschaftsakteur sämtliche Kosten trägt, auch durch den Verbraucher selbst erfolgen. Beim Ersatz genügt ein sicheres Produkt desselben Typs mit mindestens gleichem Wert und gleicher Qualität – es darf (theoretisch) sogar ein gebrauchtes Produkt sein. Besonders einschneidend ist die Erstattung des Produktwertes: Der Verbraucher erhält mindestens den von ihm gezahlten (brutto-)Kaufpreis, ungeachtet dessen, ob der Hersteller oder Importeur diesen Preis überhaupt beeinflusst oder vereinnahmt hat. Damit verlagert die GPSR Kostenrisiken auf vorgelagerte Vertriebsstufen, die zum Verbrauchervertrag grundsätzlich keine unmittelbare Beziehung haben.
Abgrenzung zur bisherigen Rechtslage: Wo Artikel 37 GPSR die Spielregeln neu schreibt
Die wesentlichen Unterschiede zur klassischen kaufrechtlichen Gewährleistung sind klar konturiert und für die Praxis gravierend:
Erstens weitet Artikel 37 den Kreis der Anspruchsgegner deutlich aus. Während das Gewährleistungsrecht grundsätzlich nur den Vertragspartner des Verbrauchers bindet, richtet sich der Abhilfeanspruch der GPSR gegen alle für den sicherheitsrelevanten Mangel verantwortlichen Wirtschaftsakteure, also insbesondere Hersteller, Importeure und Händler. Damit werden Verantwortung und Kostenlast entlang der gesamten Lieferkette verschoben.
Zweitens entfällt eine feste Verjährungsfrist. Der Abhilfeanspruch ist nicht befristet, sondern faktisch durch die Lebensdauer des Produkts im Feld begrenzt. Das bedeutet, dass die Haftung solange fortbesteht, bis das letzte Produkt aus dem Verkehr ist. Für die betroffenen Unternehmen führt dies zu einem zeitlich kaum kalkulierbaren Risiko, das in dieser Form im Gewährleistungsrecht nicht existiert.
Drittens gibt es keinen Nutzungsersatz beim Ersatz des Produktwerts. Selbst nach jahrelanger, intensiver Nutzung kann der volle (brutto-)Kaufpreis zu erstatten sein, obwohl das Produkt tatsächlich nur noch einen minimalen Restwert hat. Die Möglichkeit, den Ersatzwert über einen gebrauchten gleichwertigen Artikel zu kompensieren, ist zwar angelegt, wird aber praktisch dort an Grenzen stoßen, wo ganze Chargen betroffen sind und entsprechende Austauschprodukte nicht in ausreichender Menge verfügbar sind.
Viertens wechselt die Handlungslogik von passiv zu proaktiv. Im Gewährleistungsrecht reagiert der Schuldner typischerweise auf geltend gemachte Ansprüche. Nach der GPSR muss der verantwortliche Wirtschaftsakteur aktiv handeln und dem Verbraucher im Rahmen der Rückrufanzeige zwei Abhilfemöglichkeiten seiner Wahl anbieten. Damit werden Kommunikations- und Organisationspflichten in Rückfallsituationen massiv verschärft.
Fünftens wird der Ersatzgegenstand anders definiert. Statt eines neuen, mangelfreien Produkts (vgl. § 439 Abs. 1, 2. Var. BGB) genügt unter der GPSR ein sicheres Produkt gleichen Typs mit gleichem Wert und gleicher Qualität – gegebenenfalls gebraucht. Dies erleichtert theoretisch die Erfüllung, löst aber in der Breite keineswegs das Nutzungsersatzproblem; vielmehr droht eine Kostenlast, die sich bei flächendeckenden Rückrufen rasch potenziert. Denn auch nach Artikel 37 GPSR dürfte bei Lieferung einer Ersatzsache kein Nutzungsersatz durch den Verbraucher zu erstatten sein.
Sechstens sind Zweck und Zielrichtung unterschiedlich. Gewährleistung behebt Vertragswidrigkeiten; Artikel 37 GPSR adressiert ausschließlich sicherheitsrelevante Mängel, um gefährliche Produkte vom Markt zu nehmen und einen angemessenen Ausgleich zu schaffen. Eine Minderung, bei der das Produkt in seinem gefährlichen Zustand im Zugriff des Verbrauchers verbleibt, ist daher als Abhilfemaßnahme ausgeschlossen. Beide Regelungssysteme bestehen nebeneinander, verfolgen aber unterschiedliche Schutzrichtungen.
Haftungsrisiko für Hersteller: Ausweitung mit Dauerwirkung
Für Hersteller bedeutet Artikel 37 GPSR eine deutliche, materiell spürbare Erweiterung des Haftungsrisikos. Sie haften fortan nicht nur für vertragliche Beziehungen im eigenen Vertriebsweg, sondern auch gegenüber Endverbrauchern, ohne den Kaufpreis oder die Vertragsbedingungen kontrolliert oder erhalten zu haben. Die Pflicht zur Erstattung des vom Verbraucher gezahlten Kaufpreises kann – insbesondere bei Inflationsschwankungen oder Preisgestaltungen des Handels – anspruchsvolles Liquiditätsmanagement erfordern. Hinzu kommt die Notwendigkeit, über die mutmaßliche Lebensdauer eines Produkts hinweg Ersatzteile und Austauschmöglichkeiten vorzuhalten. Scheitern Beschaffung oder Austausch an Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit, bleibt regelmäßig nur die Erstattung, für die der Einwand „Unmöglichkeit“ typischerweise nicht durchgreift.
Versicherbarkeit und Rückstellungsbildung werden durch die fehlende zeitliche Begrenzung erschwert. Unternehmen sehen sich einem langlaufenden, operativ wie bilanziell anspruchsvollen Risiko gegenüber, das in der Risikosteuerung neue Prozesse, Dokumentationsstandards und Governance-Strukturen erfordert.
Praxisfolgen und strategische Implikationen
In der Praxis wird die Erstattung des Kaufpreises häufig die kostenintensivste Abhilfemaßnahme sein, sodass Unternehmen wohl vorrangig Reparatur und Ersatz als Abhilfemöglichkeit anbieten dürften. Dies setzt eine belastbare Ersatzteilstrategie und belastbare Lieferketten voraus – über Zeiträume, die weit über die klassische Gewährleistungsfrist hinausgehen. Vor dem Hintergrund der proaktiven Pflichten gewinnen Produktbeobachtung, lückenlose Dokumentation, schnelle Reaktions- und Kommunikationsketten sowie konsistente Rückrufprozesse zentrale Bedeutung.
Eine sorgfältige Abwägung zwischen Rückruf und Sicherheitswarnung kann in Grenzfällen sinnvoll sein und wird zukünftig weitere Bedeutung gewinnen. Denn nur der Rückruf löst die Rechtsfolgen des Artikel 37 aus. Gleichwohl bleibt die Compliance-Perspektive maßgeblich: Sicherheitswarnungen dürfen nicht als bloßes Ausweichmanöver missverstanden werden, wenn die Schwelle zum Rückruf objektiv überschritten ist.
Schließlich ist mit nationalen Sanktionsregelungen zu rechnen. Artikel 44 GPSR verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften über Sanktionen zu erlassen; die konkrete Ausgestaltung bleibt dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten. Unternehmen sollten daher nicht nur die materiell-rechtlichen Anforderungen, sondern auch die behördliche Durchsetzung und mögliche Bußgeldrahmen in ihre Compliance-Architektur integrieren.
Fazit
Artikel 37 GPSR hebt das Abhilferegime für Sicherheitsmängel auf eine neue, verbraucherschutzorientierte Ebene. Für Hersteller, Importeure und Händler bedeutet dies eine substanzielle Erweiterung der Haftungs- und Handlungspflichten – mit unbefristeter Laufzeit, fehlendem Nutzungsersatz bei Ersatz des Produktwerts und unmittelbarer Passivierung der Kosten über Rückrufe hinweg. Wer die neuen Anforderungen frühzeitig in Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, Vertragsgestaltung und Krisenprozesse integriert, reduziert nicht nur Haftungsrisiken, sondern schafft belastbare Strukturen für die rechtssichere Bewältigung von Rückfällen im Markt.

Melden Sie sich hier zu unserem GvW Newsletter an - und wir halten Sie über die aktuellen Rechtsentwicklungen informiert!