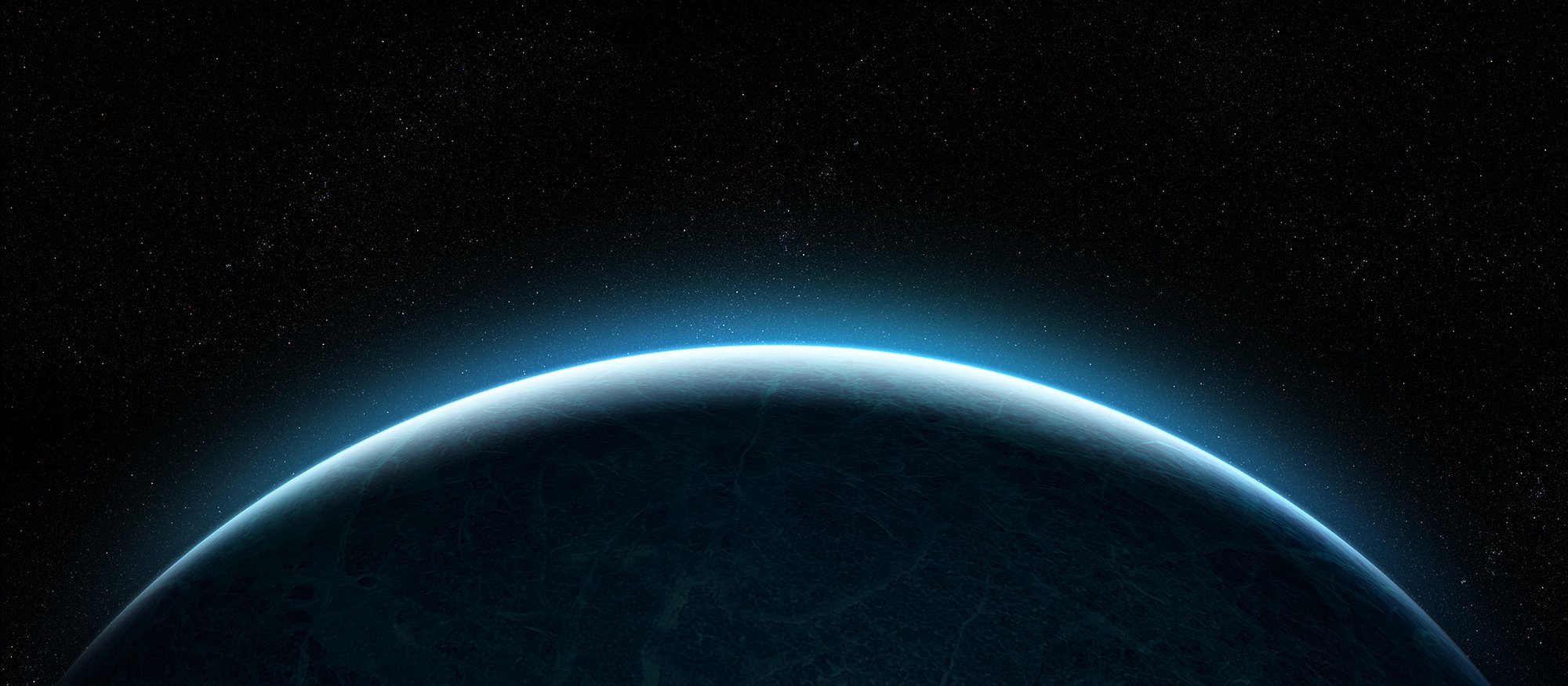Europa im Orbit: Der EU Space Act als rechtlicher Meilenstein einer strategischen Raumfahrtpolitik
Am 25. Juni 2025 hat die EU-Kommission den lang erwarteten Vorschlag für ein EU-Weltraumgesetz („EU Space Act“) vorgelegt. Bis zum 11. September 2025 können Interessierte Stellung nehmen.
Der Vorschlag ist ehrgeizig. Inhaltlich zeigt sich breites Spektrum verbindlicher Anforderungen, die von der Genehmigung weltraumbasierter Aktivitäten über Verpflichtungen zur Registrierung und Überwachung von Weltraumaktivitäten, über technische und operationelle Vorgaben zur Sicherheit, Resilienz und Umweltverträglichkeit bis hin zu spezifischen Anforderungen an das Risikomanagement und die Cybersicherheit reichen. Der Entwurf sieht vor, dass sämtliche Akteure erfasst werden, sofern sie Weltraumaktivitäten in der EU durchführen oder weltraumbasierte Daten und Dienste im Unionsmarkt anbieten. Auch Drittstaatenbetreiber, die ihre Dienste oder Daten in der EU bereitstellen, unterliegen den Regelungen
Technologische und wirtschaftliche Stärke trifft rechtliche Fragmentierung
Europäische Raumfahrtprogramme wie IRIS² (sichere Satellitenkommunikation), Copernicus (Erdbeobachtung), Galileo (Navigationssystem) und ClearSpace-1 (Weltraummüllbeseitigung) unterstreichen eindrucksvoll die technologische Exzellenz der Europäischen Union. Ebenso zeugen die zahlreichen Start-ups und Scale-ups, die mit innovativen Geschäftsmodellen das dynamische Wachstum des europäischen Weltraumsektors maßgeblich vorantreiben, von der hohen Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Branche. Nach Einschätzung der Europäischen Kommission wird der Weltraumsektor bis zum Jahr 2031 voraussichtlich rund 20 % des auf 700 Mrd. EUR geschätzten Volumens des EU-Binnenmarkts ausmachen.
Die Akteure in den Weltraummärkten operieren jedoch bislang in einem rechtlich fragmentierten Umfeld. International wird die Weltraumnutzung seit Jahrzehnten auf Basis verbindlicher völkerrechtlicher Verträge, ergänzt durch zahlreiche Resolutionen, Empfehlungen und Richtlinien, reguliert. Führend ist hierbei das United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space (UNCOPUOS). Dessen Arbeit umfasst auch und gerade Empfehlungen an die Vertragsstaaten – zu denen auch die EU-Mitgliedstaaten gehören – zur Umsetzung der völkervertragsrechtlichen Verpflichtungen auf nationaler Ebene. In der EU haben 13 der 27 Mitgliedstaaten mittlerweile nationale Weltraumgesetze, die insbesondere Regelungen zu Genehmigung und rechtlichen Rahmenbedingungen von Weltraumaktivitäten enthalten, einschließlich Vorschriften zu Haftung und Versicherung.
Die EU-Kommission sieht in dieser rechtlichen Fragmentierung insgesamt ein Hindernis für die Entwicklung des Binnenmarktes in diesem Bereich. Ein harmonisierter Rechtsrahmen für Raumfahrtaktivitäten soll die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Weltraumsektors stärken, Investitionen und Innovationen fördern, administrative Hürden abbauen und die EU als globalen Standardsetzer für sichere, resiliente und nachhaltige Weltraumaktivitäten etablieren.
Welche Bereiche bleiben außen vor?
Vom Anwendungsbereich des EU-Weltraumgesetzes ausdrücklich ausgenommen sind raumfahrtbezogene Aktivitäten im Bereich der Verteidigung und der nationalen Sicherheit – unabhängig davon, ob sie von staatlichen oder privaten Akteuren durchgeführt werden.
Ebenfalls nicht erfasst sind die Verwaltung und Zuteilung von Frequenz- und Orbitrechten, die für den Betrieb weltraumgestützter Infrastrukturen – etwa für Kommunikation, Navigation oder Internetdienste – essenziell sind. Dieser Bereich unterliegt einem eigenständigen, komplexen Geflecht aus völkerrechtlichen, unionsrechtlichen und nationalen Regelungen und bleibt für die Raumfahrtwirtschaft von zentraler Bedeutung.
Vorgaben zu Haftung und Versicherung, die in nationalen Gesetzen (unterschiedlich) geregelt und von erheblicher Bedeutung gerade für Start-Ups und KMU sind, bleiben den EU-Mitgliedstaaten vorbehalten.
Wer ist betroffen?
Betroffen sind alle Akteure, die weltraumbasierte Geschäftsmodelle umsetzen. Hierzu gehören
- Raumunternehmen und –betreiber (Space Operators): große etablierte Unternehmen (bspw. Airbus Defense and Space, OHB SE), kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Start-ups und sogenannte „New Space“-Akteure, die Satelliten, Trägerraketen oder andere Weltrauminfrastruktur betreiben, entwickeln, starten oder kontrollieren (bspw. GomSpace/Dänemark, Unseenlabs/Frankreich, Isar Aerospace/Deutschland),
- Anbieter von Weltraumdiensten und –daten, die auf Basis von Satelliteninfrastruktur Dienstleistungen wie Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation oder In-Orbit-Services anbieten (bspw. Eutelsat, SES, Planet Labs Germany),
- Betreiber von Start- und Bodeninfrastruktur, die Startplätze, Kontrollzentren oder andere bodengestützte Infrastruktur für Weltraumaktivitäten bereitstellen und betreiben (bspw. Andoya Space/Norwegen),
- Forschungseinrichtungen und Hochschulen, die Weltraummissionen durchführen, Satelliten entwickeln oder experimentelle Technologien im Orbit testen (bspw. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer-Institute),
- internationale Organisationen mit Weltraumbezug, d.h. Organisationen, die Weltrauminfrastruktur betreiben oder technische Bewertungen für EU-Mitgliedstaaten durchführen (bspw. ESA, EUMETSAT), und
- Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten, die Weltraumdienste oder –daten im EU-Binnenmarkt anbieten wollen (bspw. SpaceX, OneWeb).
Was soll geregelt werden?
In 120 Artikeln und 10 Anhängen regelt der Entwurf umfassend alle Phasen von Weltraumaktivitäten – von Genehmigung bis End-of-Life. Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zu weiteren Konkretisierungen werden noch folgen. Der Vorschlag sieht insbesondere folgende Regelungen vor:
- Genehmigungspflicht: Jede weltraumbezogene Aktivität bedarf einer behördlichen Genehmigung, wobei die Anforderungen an die Sicherheit, Resilienz und Umweltverträglichkeit nachzuweisen sind. Für Konstellationen gibt es ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
- Registrierungspflichten: Alle genehmigten Aktivitäten und Betreiber werden in einem zentralen Unionsregister für Weltraumobjekte (URSO) erfasst. Auch Drittstaatenbetreiber und internationale Organisationen müssen sich registrieren lassen, sofern sie im Unionsmarkt tätig sind.
- Technische und operationelle Vorgaben: Es gelten detaillierte Anforderungen zur Vermeidung und Reduktion von Weltraummüll, zur Nachverfolgbarkeit von Objekten, zur Nutzung von Kollisionsvermeidungsdiensten, zur Begrenzung von Licht- und Funkverschmutzung sowie zur sicheren Entsorgung am Ende der Lebensdauer.
- In-Space Operations and Services (ISOS): Unternehmen, die Dienstleistungen an Raumfahrzeugen oder anderen Objekte im Orbit durchführen (bspw. Inspektion, Wartung, Reparatur, Betankung, Umbau, Transport), müssen ab dem Jahr 2034 die festgelegten Anforderungen erfüllen. Union-eigene Raumfahrtgüter (Union owned assets), die über der Mini-Satelliten-Klasse liegen und von Union Space Operators betrieben werden, müssen über technische Mindestfähigkeiten verfügen, um In-Space-Services empfangen zu können.
- Risikomanagement und Cybersicherheit: Betreiber müssen umfassende, auf die Besonderheiten des Weltraumsektors zugeschnittene Risikomanagementsysteme implementieren, die sowohl physische als auch digitale Bedrohungen abdecken. Für kritische Infrastrukturen gelten erhöhte Anforderungen, und die Verordnung fungiert als lex specialis gegenüber der NIS2- und CER-Richtlinie.
- Umweltverträglichkeit: Es besteht die Pflicht zur Berechnung und Deklaration des ökologischen Fußabdrucks der jeweiligen Weltraumaktivität über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Methodik hierfür wird unionsweit vereinheitlicht.
- Einrichtung technisch qualifizierter Stellen (Qualified Technical Bodies – „QTB“): QTBs sind zuständig für technische Bewertungen hinsichtlich der Erfüllung der vorgesehenen technischen Anforderungen. Sie unterstützen die nationalen Behörden bei der Erteilung von Genehmigungen für Weltraumaktivitäten und verifizieren Nachweise, etwa bei der Berechnung des Umwelt-Fußabdrucks von Raumfahrtmissionen. QTBs werden von den Mitgliedstaaten benannt und überwacht.
- Durchsetzung und Sanktionen: Nationale Behörden erhalten weitreichende Überwachungs-, Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen bis hin zum Entzug der Genehmigung.
- Gegenseitige Anerkennung und Marktzugang: Genehmigungen eines Mitgliedstaats werden grundsätzlich unionsweit anerkannt, wobei einzelne Mitgliedstaaten bei objektivem Bedarf strengere Anforderungen für Aktivitäten auf ihrem Territorium stellen können;
- Unterstützungsmaßnahmen: Insbesondere für Start-ups, KMU und Forschungseinrichtungen sind Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen vorgesehen, um die Umsetzung der Anforderungen zu erleichtern.
Fazit
Insgesamt ist der Vorschlag ein notwendiger und richtungsweisender Impuls, der mit der Einführung einheitlicher Genehmigungs-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards mit Blick auf die zunehmende Kommerzialisierung und Internationalisierung des Orbits sachgerecht erscheint. Der Vorschlag setzt insoweit klare Maßstäbe für Space Traffic Management, Cybersicherheit und den Umgang mit Weltraummüll. Das dient sowohl dem Schutz öffentlicher Interessen als auch der langfristigen Nutzbarkeit des Weltraums.
Aber: Regulatorische Überlastung muss vermieden werden und die Innovationskraft der europäischen Weltraumwirtschaft erhalten bleiben. Insoweit dürften die vorgesehene Regulierungstiefe und die Komplexität des Vorschlags kritisch zu hinterfragen sein. Mit weitreichenden Pflichten – wie etwa zur Datenbereitstellung, technischen Nachverfolgbarkeit und Deorbitierung – droht insbesondere für KMU eine erhebliche Compliance-Belastung. Die Anforderungen sind teils technisch anspruchsvoll und könnten innovationshemmend wirken.
Zudem bleibt die praktische Durchsetzbarkeit unionsweiter Kontroll- und Sanktionsmechanismen fraglich, insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten oder Drittstaatenakteuren. Die vorgesehene zentrale EU-Koordinierungsstelle ist ein richtiger Schritt, bedarf aber klarer Kompetenzabgrenzung gegenüber nationalen Behörden.
Es bleibt spannend.

Melden Sie sich hier zu unserem GvW Newsletter an - und wir halten Sie über die aktuellen Rechtsentwicklungen informiert!